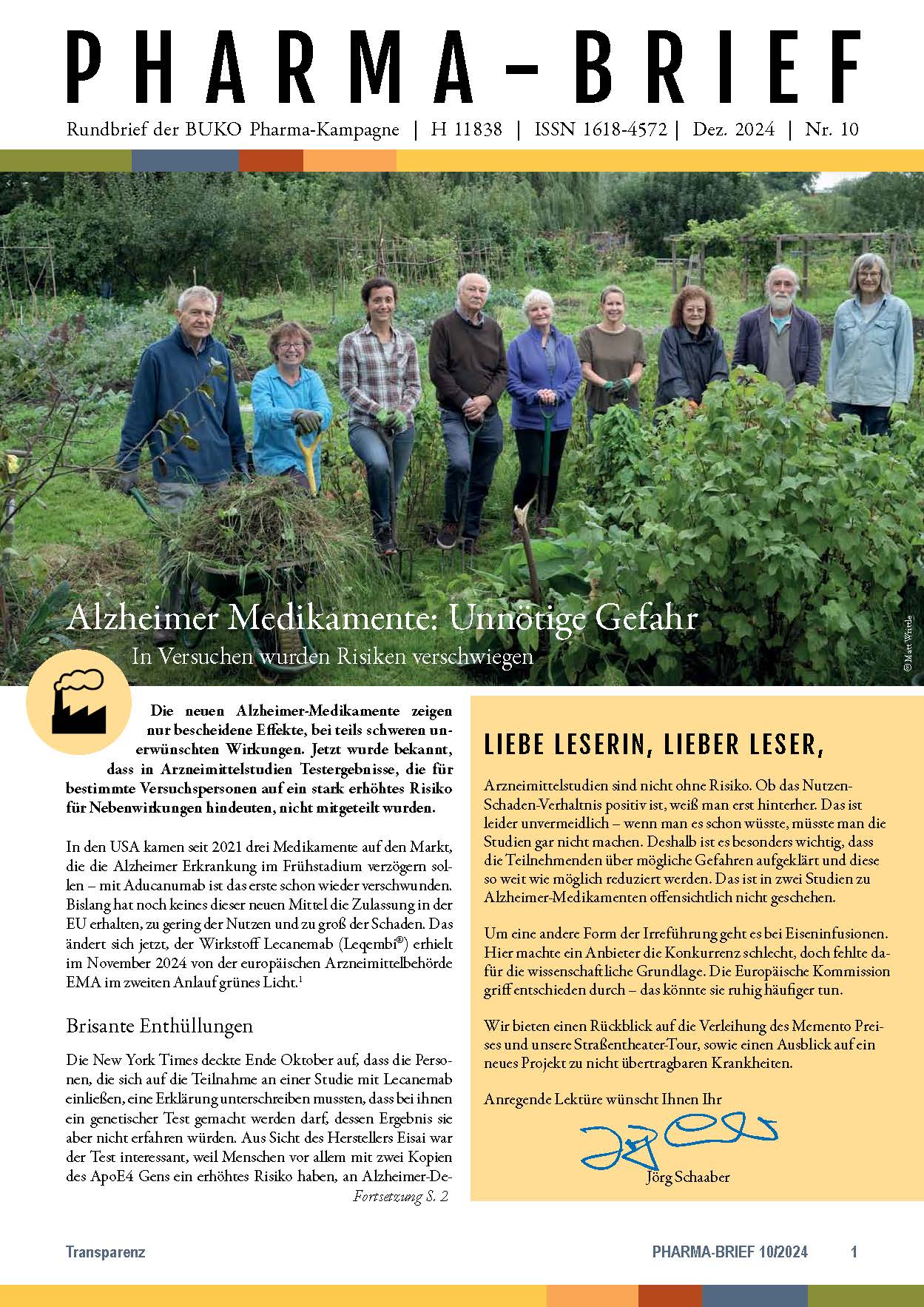
Alzheimer Medikamente: Unnötige Gefahr
21. Dezember 2024
In Versuchen wurden Risiken verschwiegen
Die neuen Alzheimer-Medikamente zeigen nur bescheidene Effekte, bei teils schweren unerwünschten Wirkungen. Jetzt wurde bekannt, dass in Arzneimittelstudien Testergebnisse, die für bestimmte Versuchspersonen auf ein stark erhöhtes Risiko für Nebenwirkungen hindeuten, nicht mitgeteilt wurden.
In den USA kamen seit 2021 drei Medikamente auf den Markt, die die Alzheimer Erkrankung im Frühstadium verzögern sollen – mit Aducanumab ist das erste schon wieder verschwunden. Bislang hat noch keines dieser neuen Mittel die Zulassung in der EU erhalten, zu gering der Nutzen und zu groß der Schaden. Das ändert sich jetzt, der Wirkstoff Lecanemab (Leqembi®) erhielt im November 2024 von der europäischen Arzneimittelbehörde EMA im zweiten Anlauf grünes Licht.1
Brisante Enthüllungen
Die New York Times deckte Ende Oktober auf, dass die Personen, die sich auf die Teilnahme an einer Studie mit Lecanemab einließen, eine Erklärung unterschreiben mussten, dass bei ihnen ein genetischer Test gemacht werden darf, dessen Ergebnis sie aber nicht erfahren würden. Aus Sicht des Herstellers Eisai war der Test interessant, weil Menschen vor allem mit zwei Kopien des ApoE4 Gens ein erhöhtes Risiko haben, an Alzheimer-Demenz zu erkranken. Was sie den Teilnehmenden nicht verrieten, war, dass genau diese Personengruppe auch erheblich häufiger Gehirnschwellungen und -blutungen erleidet. Mancher hätte sich mit diesem Wissen die Teilnahme sicherlich noch einmal überlegt. Dass es sich dabei keineswegs um ein theoretisches Problem handelt, zeigen die Ergebnisse: Von den 274 Versuchspersonen mit zwei Kopien des Risikogens erlitten 99 diese Nebenwirkungen, zwei starben an den Folgen.
Auch zweiter Anbieter hielt Tests geheim
Nicht viel besser machte es Eli Lilly, Anbieter von Donanemab (Kisunla®), das in den USA im Juli 2024 zugelassen wurde. Die Teilnehmenden mussten unterschreiben, dass sie mit einem bestimmten genetischen Profil ein höheres Risiko für Nebenwirkungen hätten, aber das Ergebnis des Gentests würde vor ihnen geheim gehalten. Die blasse Begründung: Es sei emotional belastend, wenn man erfahre, dass es eine größere Gefahr gebe, an Alzheimer zu erkranken. Von den 289 Teilnehmenden mit den Risikogenen erlitten Dutzende Gehirnblutungen, die Lilly als „schwer“ klassifizierte.
Für beide Studien gilt, dass es ungewöhnlich ist, Patientinnen gesundheitsrelevante Testergebnisse vorzuenthalten. Dem Bedenken, dass das Resultat belastend sein könnte, kann man anders begegnen: Nach Aufklärung können sich die Versuchsteilnehmer*innen selbst entscheiden, ob sie das Ergebnis mitgeteilt bekommen möchten oder nicht. Diese Option gab es in den beiden Studien nicht.
Risikoverringerung genug?
Zurück zur aktuellen Zulassung von Lecanemab in der EU. Die EMA rechtfertigte ihre nach der anfänglichen Ablehnung nun positive Empfehlung mit einer Indikationseinschränkung: Personen, die zwei Kopien des ApoE4 Gens in sich tragen, dürfen das Medikament nicht verschrieben bekommen. Bei ihnen ist die Gefahr von Gehirnblutungen zwei bis dreimal so hoch.2 Aber auch mit nur einer oder keiner Kopie betrug das Risiko für Blutungen noch 12,9%, unter Placebo war es nur 6,8%. Gehirnschwellungen, die zu Sehstörungen und Verwirrtheitszuständen führen können, kamen bei 8,9% vor, unter Placebo nur bei 1,3%.1
Bescheidener Nutzen
Den erheblichen Risiken steht ein bescheidener Nutzen gegenüber. Primär wurde der Effekt mit der „Clinical Dementia Rating – Sum of Boxes“ (CDR-SB) gemessen. Die Skala umfasst die Werte 0 bis 18, wobei höhere Werte für eine stärkere Demenz stehen. Mit Lecanemab verschlechterte sich innerhalb von 18 Monaten der CDR-SB um 1,22 Punkte, mit Placebo um 1,75 Punkte.3 Ob diese Differenz von rund einem halben Punkt für die Betroffenen überhaupt einen spürbaren Unterschied bedeutet, ist fraglich. Außerdem bleibt unklar, ob der Unterschied langfristig anhält.2 Da das Medikament den Krankheitsverlauf nicht stoppen kann, bleibt die Frage, ob der geringe Nutzen die Nebenwirkungen aufwiegt. Dazu kommt, dass das Medikament alle vier Wochen als halbstündige Infusion verabreicht wird und regelmäßige MRTs notwendig sind. (JS)
- EMA (2024) Questions and answers on: the approval of the marketing authorisation for Leqembi (lecanemab) 14 Nov [Zugriff 21.11.2024] ↩︎
- Arzneimittelbrief (2023) Neue Therapieoptionen bei Alzheimer-Demenz? 57, S. 57 ↩︎
- Berechnet auf Personen ohne zwei Kopien des Risikogens, in der Gesamtstudie betrug der Unterschied 0,45 Punkte. ↩︎
