Treffen der unabhängigen Arzneimittelzeitschriften
Alle drei Jahre trifft sich die International Society of Drug Bulletins (ISBD), um über aktuelle Entwicklungen zu diskutieren. Im Oktober war es wieder so weit. Ein Bericht aus Paris, der viele Schwachstellen bei der Medikamentenkontrolle und -Information deutlich machte.
Gleich die erste Podiumsdiskussion unter dem Titel „Das regulatorische Umfeld – wie gute Evidenz brauchen wir?“ verlief äußerst kontrovers.
Während für Jordi Llinares von der europäischen Zulassungsbehörde EMA die Welt weitgehend in Ordnung ist, sahen das die übrigen RednerInnen anders.
Claudia Wild vom Ludwig Bolzmann Institut, das in Österreich für Arzneimittelbewertungen zuständig ist, zeigte am Beispiel von Krebsmedikamenten, dass zum Zeitpunkt der Zulassung viel zu wenig über den Nutzen der Arzneimittel bekannt ist. Und was man weiß, ist nicht gerade ermutigend.[1] Legt man die Kriterien der europäischen Krebsfachgesellschaft an, zeige nur jedes Fünfte bis Zehnte Mittel einen klinisch relevanten Nutzen, so Claudia Wild. Über die Zeit betrachtet werde auch die Studienqualität immer schlechter. Immer häufiger würden Surrogatendpunkte wie progressionsfreies Überleben (PFS) statt das tatsächliche Überleben (OS) gemessen.[2]
ISDB-Präsident Dick Bijl und Sidney Wolfe von Worst Pills – Best Pills aus den USA prangerten die beschämend niedrigen Standards für die Zulassung von Antidiabetika an. Sotagliflozin war von der US-Zulassungsbehörde nur haarscharf nicht als Zusatztherapie bei Diabetes Typ 1 zugelassen worden: die Abstimmung der ExpertInnen endete mit einem Patt. Die EMA gab dem Wirkstoff hingegen im April 2019 grünes Licht, obwohl klar war, dass ein hohes Risiko für eine Ketoazidose – eine bedrohliche Übersäuerung des Blutes – besteht, so Sidney Wolfe. 
Sanofi brachte das Medikament trotz Zulassung zunächst nicht auf den Markt. Im Juni wurden neue Daten bekannt: Sotagliflozin verschlechtert die Nierenfunktion.[3] Am 26. Juli 2019 gab Sanofi das Ende der Zusammenarbeit mit der Firma Lexicon, die den Wirkstoff ursprünglich entwickelt hatte, bekannt. Als Begründung wurden explizit enttäuschende Studienergebnisse bei der Wirksamkeit genannt.[4] Sotagliflozin hatte von der EMA eine ganz normale Zulassung bekommen. Sanofi wurde lediglich auferlegt, eine Studie zur Häufigkeit von Ketoazidosen durchzuführen.
Llinares verteidigte dagegen die beschleunigte vorläufige Zulassung, selbst bei einer schwachen oder unvollständigen Evidenz. Seiner Meinung nach sei das kein Problem, da bislang nur eines der so zugelassenen Mittel wieder vom Markt genommen werden musste (zwei weitere Hersteller zogen „aus kommerziellen Gründen“ ihren Zulassungsantrag zurück). Bei den meisten der Schnellzulassungen ist nach mehreren Jahren immer noch unklar, ob und welchen tatsächlichen Nutzen die Wirkstoffe für PatientInnen haben.
Generell zeigte die Debatte, dass es doch eine erhebliche Kluft zwischen der Denkwelt der Zulassungsbehörde auf der einen Seite und unabhängigen MedikamentenbewerterInnen sowie klinisch tätigen ÄrztInnen auf der anderen Seite gibt. Während sich die Behörde mit statistisch signifikanten Ergebnissen zufrieden gibt, stellen unabhängige ExpertInnen die Frage, ob überhaupt gemessen wurde, was für PatientInnen zählt und ob die Behandlung auch zu relevanten Verbesserungen führt.
Ein weiterer Streitpunkt war die Tatsache, dass die EMA zu rund 90% durch Gebühren der Industrie finanziert wird. Llinares betonte seine Unabhängigkeit, er bekomme sein Gehalt, egal ob er positiv oder negativ entscheide. Was er dabei übersieht: Wenn die EMA strenger urteilen würde, verringerte sich die Zahl der Zulassungsanträge und damit nähmen auch die Einnahmen der Behörde drastisch ab.
Die Kunst des Weglassens
Auch sinnvolle Medikamente richten bei Überverschreibung gravierende Schäden an. Vor allem ältere Menschen nehmen oft eine große Zahl verschiedener Arzneimittel ein, ohne dass das ihrer Gesundheit nützt. Im Gegenteil, die Zahl der unerwünschten Wirkungen und Interaktionen nimmt zu. Es ist aber gar nicht so einfach, Medikamente abzusetzen. Dazu bedarf es der konstruktiven Zusammenarbeit zwischen ÄrztIn und PatientIn, dem Aufgeben liebgewordener Gewohnheiten und es braucht Mut. So reagiert nicht jeder Arzt entspannt darauf, wenn jemand weniger Medikamente schlucken möchte. Dee Mangin berichtete über diese Klippen und wie man sie überwindet. Sie entwickelte in Kanada gemeinsam mit KollegInnen eine Software, die das „Entschreiben“ (De-prescribing, im Gegensatz zu Verschreiben) erleichtert.[5] Anne Sophie Parent von der AGE-Platform ergänzte die Diskussion aus PatientInnensicht.
Wes Brot ich ess
Interessenkonflikte spielen eine immer noch unterschätzte Rolle in der Medizin. Einen erfrischenden Einstieg ins Thema bot Zoé Friedmann von der Berliner Studierendengruppe von UAEM.[6] Sie setzt sich für Unabhängigkeit in der Lehre ein. Es ist ungut, wenn ProfessorInnen in Vorlesungen bestimmte Medikamente in den Vordergrund stellen, ohne ihre Interessenkonflikte offenzulegen. UEAM untersuchte in einer kleinen Studie, wie deutsche Medizinfakultäten mit dem Problem umgehen. Das Ergebnis ist gelinde gesagt ernüchternd (mehr dazu auf S. 2).
Danach ging es um die Unabhängigkeit der Cochrane Collaboration. Im vergangenen Jahr hatte sie sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert als sie das Vorstandsmitglied Peter Gøtzsche erst von seinen Aufgaben entband und ihn als Gründungsmitglied dann sogar ganz ausschloß. Sein „Vergehen“: er hatte den laxen Umgang mit Interessenkonflikten kritisiert und daraus resultierende fehlerhafte Analysen von Cochrane kritisiert.[7] Juan Erviti aus Pamplona, einer der Koordinatoren der Cochrane Hypertension Group – eine der Gruppen, die das Thema Interessenkonflikte sehr ernst nimmt – beschrieb den Umgang mit durch Beeinflussung verzerrten Daten. Er berichtete auch, dass der Skandal um Peter Gøtzsche bereits einiges verändert habe. Die Regelungen zu Interessenkonflikten würden künftig verschärft. Aber in der anschließenden Diskussion wurde deutlich, dass das nicht reicht. Das meinte nicht nur Gøtzsche, der in Paris anwesend war, und sein neu gegründetes Institute for Scientific Freedom vorstellte.[8]
Big Data – Big Problems
Gerd Antes, ehemaliger Leiter des deutschen Cochrane-Zentrums beleuchtete in seinem Vortrag die Chancen und Risiken der Auswertung großer Datenmengen aus dem Internet und aus anderen Datensammlungen. Schon der Titel seines Vortrags „Big Data – marketinggetriebener Hype versus wissenschaftsbasierter Fortschritt, wohin gehen wir?“ machte deutlich, dass er große Gefahren sieht.[9] Ausgangspunkt ist der Goldstandard in der Medizin. Als wichtigste Faktoren sieht er bei der Erkenntnisgewinnung die Minimierung von systematischen Fehlern (risk of bias) und die Kontrolle von zufälligen Fehlern. Randomisierte kontrollierte Studien können – wenn sie gut gemacht sind – wichtige Wissensfortschritte generieren. Dabei gibt es allerdings das Problem, dass rund die Hälfte aller Studien nicht veröffentlicht werden. Also ist schon die Gegenwart alles andere als ideal. Doch bringt die Zukunft Fortschritte?
Bereits seit einiger Zeit geistert der unscharfe Begriff „Real World Data“ durch die Fachblätter. Der angebliche Vorteil: Es würden PatientInnen im Behandlungsalltag erfasst, die gefundenen Ergebnisse seien also praxisnäher. Dabei drohen allerdings grundlegende wissenschaftstheoretische Erkenntnisse ohne Not über Bord geworfen zu werden. Die so erfassten Daten sind nämlich von unterschiedlicher Qualität, es gibt keine Kontrollgruppen und durch die Auswahl der Daten können die tatsächlichen Behandlungseffekte grob über- oder unterschätzt werden.
Aktuell ist der Begriff „Big Data“ in aller Munde. Es existieren große Datensätze, die oft zu anderen Zwecken gesammelt wurden, aber möglicherweise gesundheitsrelevante Informationen enthalten. Die populäre Vorstellung, man muss die Daten nur geschickt auswerten, und kommt so zu bahnbrechenden neuen Erkenntnissen, ist aber schlichtweg falsch. Wenn unstrukturierte Daten analysiert werden, besteht die Gefahr, dass so lange ausgewertet werden, bis ein „Ergebnis“ dabei herauskommt. Solche Ergebnisse sind überdies nicht reproduzierbar, weil jede Sekunde neue Daten hinzukommen. Je mehr Daten man analysiert, umso mehr Korrelationen kann man finden, aber Korrelationen sind noch keine Kausalität. Man denke nur an die Zahl der Störche und die Geburtenrate.
Die praktischen Versuche mit Big Data in der Medizin sind bislang ziemlich ernüchternd. Google scheiterte mit seinem Versuch, Grippeepidemien vorherzusagen. Und IBM wollte mit „Watson“ und künstlicher Intelligenz die Krebsdiagnose und ‑behandlung verbessern. Der Erfolg blieb trotz großen Aufwands aus. Was als Geschäftsmodell in der Warenwelt funktioniert, die Vorlieben von InternetnutzerInnen für Produkte zu erkennen und zielgerichtete Werbung zu schalten, lässt sich nicht eben einfach auf Gesundheit übertragen.
Durch immer mehr Daten besteht die Gefahr, nur den sprichwörtlichen Heuhaufen zu vergrößern, nicht aber die Anzahl der Nadeln, die man finden kann. Statt von „Künstlicher Intelligenz“, so Antes, könne man ebenso von „Künstlicher Dummheit“ sprechen. Jüngstes Beispiel seien die Abstürze von zwei Boeing 737 MAX8s, die durch „mitdenkende“ Software ausgelöst wurden.
Trotz all dieser Bedenken propagieren sowohl die EMA wie die FDA die Verwendung von „Real World Evidence“, wie Rita Banzi vom italienischen Mario Negri Institut zeigte. Besonders bei (zu) frühen Zulassungen von Arzneimitteln spielen zunehmend unstrukturierte Daten eine Rolle.
Die dunkle Seite der Medizin
Unerwünschte Arzneimittelwirkungen sind ein Stiefkind der Medizin. PatientInnen möchten sie nicht erleiden, ÄrztInnen wollen nicht daran schuld sein und für die Industrie sind sie umsatzschädlich. Auch die Kontrollbehörden beschäftigen sich nur ungern damit, könnte man ihnen doch vorwerfen, bei der Zulassung nicht genau genug hingeschaut zu haben.
Antidepressiva können langanhaltende Sexualstörungen verursachen. Der britische Psychiater David Healy (RxISK[10] ), sorgte jüngst dafür, dass diese Nebenwirkung Eingang in die Beipackzettel findet. Die Bereitschaft von PatientInnen, ihr Leiden öffentlich zu machen, war die Voraussetzung dafür.
Marine Martin von APESAC in Frankreich[11] berichtete in Paris als Betroffene über das Valproat-Syndrom. Wenn Schwangere das Epilepsiemedikament nehmen, kann ihr Nachwuchs schwer geschädigt werden. Auch hier dauerte es lange, bis die Berichte der Mütter über geschädigte Kinder ernstgenommen wurden.
Die Opioidkrise in den USA thematisierte Adriane Fugh-Berman von der Georgetown University in Washington. 2017 starben in den USA 49.000 Menschen an einer Überdosis, davon hatten 19.000 das Mittel auf Rezept erhalten und häufig auch in der verordneten Dosis eingenommen. Fugh-Berman zeigte, wie die Hersteller, allen voran Purdue, mit massiven Werbekampagnen die Ausweitung der Indikation – die sich ursprünglich auf Schmerzen bei Krebs beschränkte – vorangetrieben haben. Dabei wurde nicht nur auf Anzeigen gesetzt, sondern es wurden auch Meinungsführer in der Ärzteschaft eingekauft. Und das keineswegs nur in den USA. Grünenthal und Mundipharm, die europäische Schwestergesellschaft von Purdue, zahlten dem italienischen Arzt Guido Fanelli über Jahre insgesamt über eine Million €. Er veröffentlichte nicht nur zahlreiche wissenschaftliche Artikel, die die Gefahren von Opioiden verschleierten. Außerdem organisierte er als Strohmann eine Konferenz, bei der die Firmen die ReferentInnen auswählten. Fanelli war auch Ideengeber für ein Gesetz, dass in Italien die Verschreibung von Opioiden bei chronischen Schmerzen erleichterte. Doch seine verdeckten Aktionen flogen auf. Fanelli wurde nicht nur von seinem Posten im Krankenhaus suspendiert, er darf auch bis zum Abschluss des Falls nicht als Arzt arbeiten.[12]
Barbara Mintzes von der Universität Sydney berichtete über ein von Australien und Kanada gefördertes internationales Projekt zur Risikokommunikation. Dabei wurden Sicherheitswarnungen der Behörden Australiens, Kanada, Großbritanniens und der USA über zehn Jahre (2007-2016) verglichen.[13] Insgesamt wurden 1.441 Warnungen zu 680 Medikamenten oder Wirkstoffgruppen gefunden. Erstaunlich gering war die Übereinstimmung: Warnungen in einem Land lösten häufig keine in den anderen Ländern aus. Betrachtet man nur die Warnungen zu den 573 Medikamenten(gruppen), die überall erhältlich waren, wurden nur 40 in allen vier Ländern veröffentlicht, also nicht einmal jede Zehnte.
Fake news
Mit der Berichterstattung über Arzneimittel beschäftigte sich der Vor-
trag von Alan Cassels von der kanadischen Therapeutics Initiative.[14] Er machte deutlich, wie weit der Einfluss der Pharmaindustrie auch in die etablierte Tagespresse hinein reicht. Und damit auch die Klientel der ÄrztInnen und WissenschaftlerInnen erreicht. Bereits seit fast 30 Jahren ist bekannt, dass Fachartikel, über die in der Laienpresse berichtet wird, anschließend von WissenschaftlerInnen häufiger zitiert werden.[15] Auswahlkriterium ist für die JournalistInnen aber nicht unbedingt die Qualität der Studien sondern das erwartete öffentliche Interesse an der Thematik. Statt vorrangig über randomisierte Studien zu berichten, die die zuverlässigsten Ergebnisse liefern können, werden in der Berichterstattung oft fehleranfälligere Beobachtungsstudien aufgegriffen – und dann auch noch methodisch schlechte.[16]
Einen ganz anderen Input lieferte Anna Coretchi vom moldawischen Bulletin MEDEX. Sie hat eine fünfzehnjährige Karriere als TV-Journalistin hinter sich, und ist bis heute mit Medizinthemen im Fernsehen präsent. Sie ermutigte die Bulletins, aktiv auf die Presse zuzugehen.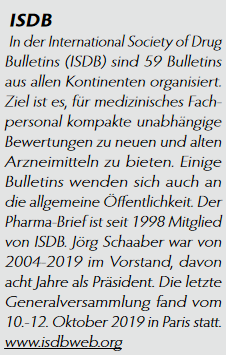
Arbeit voraus
 Die Tagung zeigte nicht nur wichtige Problembereiche auf, die einer rationalen Anwendung von Medikamenten im Wege stehen, sie diente auch zur Orientierung, wo ISDB in den nächsten drei Jahren Schwerpunkte setzen könnte. Bessere Studien und strengere Zulassungsbedingungen einzufordern, gehört ebenso auf die Agenda von ISDB wie mehr Transparenz bei Studienergebnissen. Auch vernachlässigten Themen wie „weniger verschreiben“ und „mehr auf unerwünschte Wirkungen achten“, dürften künftig sicherlich stärker in den Fokus rücken. (JS)
Die Tagung zeigte nicht nur wichtige Problembereiche auf, die einer rationalen Anwendung von Medikamenten im Wege stehen, sie diente auch zur Orientierung, wo ISDB in den nächsten drei Jahren Schwerpunkte setzen könnte. Bessere Studien und strengere Zulassungsbedingungen einzufordern, gehört ebenso auf die Agenda von ISDB wie mehr Transparenz bei Studienergebnissen. Auch vernachlässigten Themen wie „weniger verschreiben“ und „mehr auf unerwünschte Wirkungen achten“, dürften künftig sicherlich stärker in den Fokus rücken. (JS)
Artikel aus dem Pharma-Brief 7-8/2019, S.3
Bild Tagungsmitglieder © Benoit Marchand
Bild Gebäude © Jörg Schaaber
[1] Grössmann N et al. (2019) Monitoring evidence on overall survival benefits of anticancer drugs approved by the European Medicines Agency between 2009 and 2015. Eur J Cancer; 110, p 1
[2] Kordecka A et al. (2019 Selection of Endpoints in Clinical Trials: Trends in European Marketing Authorization Practice in Oncological Indications. Value in Health; 22, p 884
[3] Müller C (2019) Sotagliflozin– reduziert Blutdruck und Nierenfunktion? DAZ online www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2019/06/12/sotagliflozin-reduziert-blutdruck-und-nierenfunktion [Zugriff 2.11.2019]
[4] Sanofi (2019) Sanofi provides update on ZynquistaTM
(sotagliflozin) type 2 diabetes Phase 3 program and collaboration with Lexicon. Press release 26 July www.sanofi.com/en/media-room/press-releases/2019/2019-07-26-22-05-00 [Zugriff 2.11.2019]
[6] Universities Allied for Essential Medicines
[7] Pharma-Brief (2018) Kritiker rausgeworfen. Nr. 8/9, S. 7
[9] Einen Vortrag von Gerd Antes zum Thema von 2018 kann hier angesehen werden: https://cast.itunes.uni-muenchen.de/clips/0U9YuGalbb/vod/high_quality.mp4
[11] www.oacscharity.org/apesac
[12] Galofaro C (2019) ‘Pain League’ allegedly pushed opioids in Italy. AP https://apnews.com/5d085839c808473eaabd0a3b57c485e0
[13] Perry LT et al. (2019) Comparative analysis of medicines safety advisories released by Australia, Canada, the United States, and the United Kingdom. JAMA Internal Medicine; 179, p 982
[14] Moynihan R and Casssels A (2005) Selling sickness. Vancouver: Greystone Books
[15] Phillips DP et al. (1991) Importance of the lay press in the transmission of medical knowledge to the scientific community. NEJM; 325, p 1180
[16] Selvary S et al. (2014) Media Coverage of Medical Journals: Do the Best Articles Make the News. PLOS one; 9, p e85355

